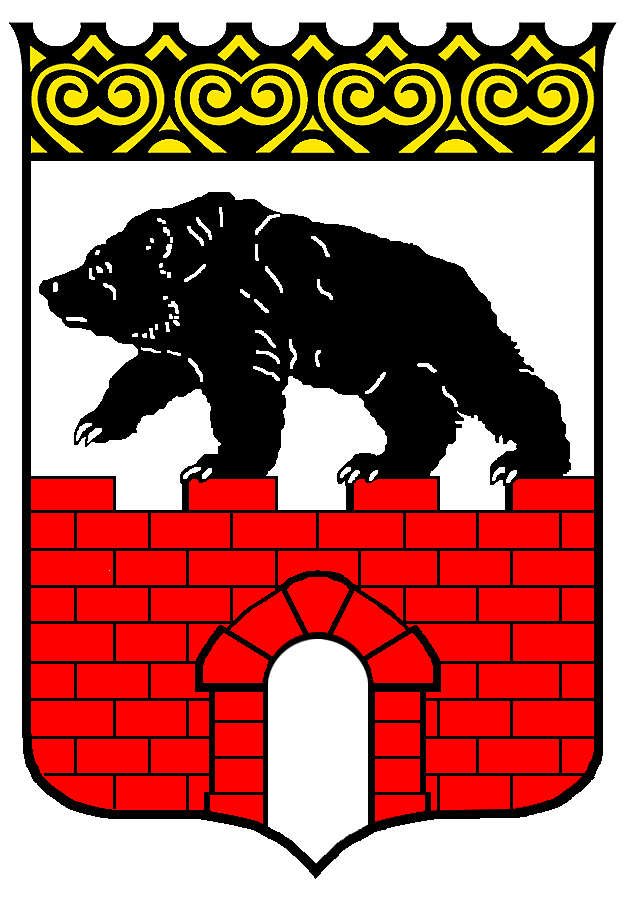Spendenaufruf für eine Gedenktafel zu Ehren Baronin von Cohn-Oppenheim
Sehr geehrte Damen und Herren,
noch heute künden Gebäude, Einrichtungen und Kulturgut vom großherzigen Wirken der Frau Baronin Julie von Cohn – Oppenheim (1839-1903), die dank zweier testamentarisch hinterlassener Stiftungen finanziert werden konnten. Das Gesundheitsbad (heute Stadtschwimmhalle) in der Askanischen Straße, das Gymnasium Philanthropin, die frühere Handelsrealschule und auch der Wiederaufbau des 1910 durch einen Brand zerstörten Rathauses konnten daraus finanziert werden.
Ihre Bestimmungen sahen aber auch bahnbrechende Neuerungen zur Verbesserung der Hygienebedingungen in der Stadt vor. Die städtische Desinfektionsanstalt und – schule sowie das Krematorium künden davon.
Für ihr segensreiches Wirken verlieh ihr als erster Frau die Stadt Dessau am 30. April 1901 die Ehrenbürgerwürde.
Ihre Grabstätte befindet sich allerdings ohne jeglichen Verweis auf ihre letzte Ruhestätte auf dem Israelitischen Friedhof zu Dessau. Das Postament zu ihrem Gedächtnis ist seit Jahrzehnten ohne Erinnerungstafel. Diese möchten wir nun dank auch Ihrer Spenden am Original angelehnt erneuern, worum ich Sie im Namen des Vereins für Anhaltische Landeskunde ganz herzlich bitten möchte.
Die voraussichtlichen Kosten betragen 2.700 Euro.
Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto des Vereins:
IBAN: DE13 8005 3722 0302 0223 25 bei der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
unter der Angabe des Zahlungsgrunds „Spende Baronin“.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit beste Grüßen
Klemens M. Koschig
Vorsitzender

Bildnachweis: privat