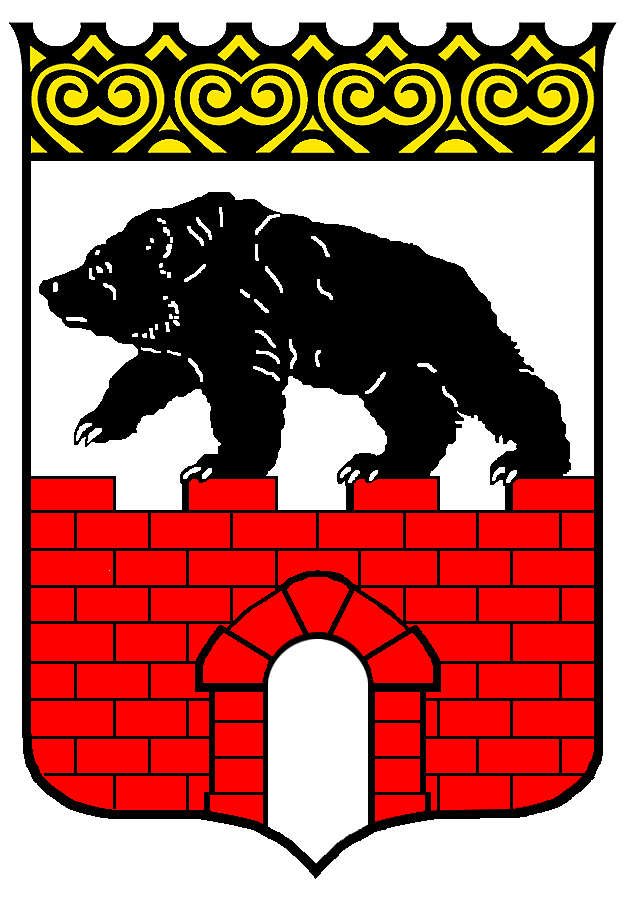Die Hungersteine in der Elbe bei Brambach. (Aufnahme vom August 2015)
Allein die Tatsache, dass mehr als 70 Besucher zum Vortrag von Gerald Schmidt zur Burg Reina am 17. September 2024 in die Roßlauer Ölmühle kamen, zeigt, welches Interesse die vor 700 Jahren untergegangene Burg noch heute weckt.
Dabei ist über die Burg nur wenig bekannt. 1215 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, 1325 wird sie bereits als wüst bezeichnet. Dass es sich bei den bei Niedrigwasser in der Nähe von Brambach am nördlichen Elbufer erscheinenden sogenannten „Hungersteinen“ nicht um die Reste von Burg Reina handelt, konnte Schmidt eindrücklich belegen und diese Theorie in den Bereich der Schiffersagen verweisen. Vielmehr scheint es sich bei den festen, steinernen Resten in der Elbe um die ehemalige Pfarrkirche des gleichnamigen Dorfes Reina zu handeln. Bauart und Ausmaße passen gut zu den vielen erhaltenen Feldsteinkirchen im Fläming und Vorfläming. Wie die Burg ging auch das Dorf zu Beginn des 14. Jahrhunderts infolge

Gerald Schmidt bei seinem Vortrag in der Roßlauer Ölmühle.
eines großen Elbhochwassers ein. Anhand des Vergleichs mit historischen Chroniken und anderen Quellen konnte Schmidt das Hochwasser, das zu einer Laufänderung der Elbe und zur Aufgabe von Burg und Dorf Reina führte, auf das Jahr 1316 eingrenzen. Doch wo genau befand sich nun die wirkliche Burg Reina und welche Bedeutung hatte sie? Auch hierzu konnte Gerald Schmidt Antworten liefern. Der Lage nach zu urteilen hat es sich bei Burg Reina um eine Grenzburg gehandelt, welche die Besitzungen der anhaltischen Grafen gegen feindlich gesinnte Nachbarfürsten schützen sollte. Ihre Lage lässt sich mit ziemlicher Sicherheit auf den bis heute sogenannten „Schlossberg“ eingrenzen, der sich auf der Dessauer Elbseite gegenüber
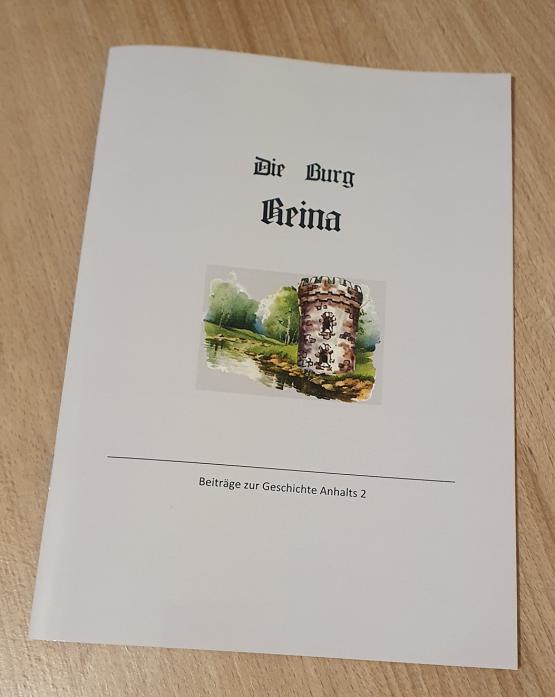
Broschüre “Die Burg Reina” von Gerald Schmidt.
dem heutigen Dorf Brambach befindet. Bei archäologischen Ausgrabungen in den Jahren 1992/93 konnte dort eine Burganlage von etwa 80 mal 40 Metern Größe auf ovalem Grundriss nachgewiesen werden. Die Burg war von einem Wassergraben umgeben. Der Burghügel der Kernburg war durch Wassergräben von zwei zu Wirtschaftszwecken dienenden Vorburgen getrennt. Auch die wenigen vorhandenen schriftlichen Quellen scheinen diesen Standort als Reste der Burg Reina zu belegen.
Seine hier nur sehr knapp zusammengefassten Forschungsergebnisse hat Gerald Schmidt in einer Broschüre zusammengetragen („Die Burg Reina“, Beiträge zur Geschichte Anhalts 2, Dessau-Roßlau 2024).
Text und Fotos: Tobias Zander